
Was möchten Sie tun?
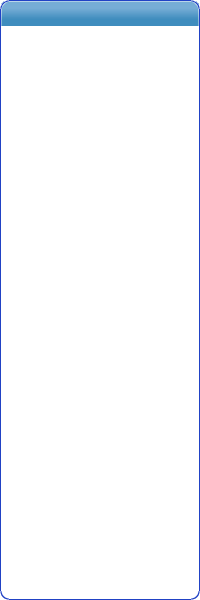
Geschichte von Schloss Ludwigslust
Bevor die Herzöge von Mecklenburg Schloss Ludwigslust als ihre Residenz entdeckten, lebten sie lange Zeit auf Schloss Schwerin, das sich schon als Burg im Besitz der Familie befunden hatte. Diese hatte man im 12. Jahrhundert eingerissen, als deutsche Feinde die Burg zu erobern drohten. Selbige besiedelten die Region dann neu und errichteten schliesslich Schloss Schwerin, das sie später an die Mecklenburger Herzöge verkauften.Doch schon bald war Schloss Schwerin nicht mehr standesgemäss. Deshalb begab man sich auf die Suche nach einem neuen Bauplatz. Fündig wurde man ein wenig ausserhalb von Schwerin auf einem Jagdsitz, der im Jahr 1724 errichtet worden war. Obwohl diese Anlage also noch vergleichsweise jung war, beschloss man im Jahr 1772, das Schlösschen abzureissen und Schloss Ludwigslust hier zu errichten. Es dauerte nur vier Jahre, bis die Bauarbeiten beendet waren und Schloss Ludwigslust bezogen werden konnte. Gestaltet worden war das neue Schloss Ludwigslust schlussendlich im spätbarocken Stil. Es hat einen E-förmigen Grundriss und wurde mit seinen kurzen Flügeln auf den Schlosspark ausgerichtet. Die Front des Schlosses hingegen weist auf den Schlossplatz.
Wie es dem damaligen Geschmack entsprach wurde Schloss Ludwigslust vor allem aus Backstein erbaut und dann mit Sandstein verkleidet. Diese Steine wurden für den Bau von Schloss Ludwigslust eigens aus dem Elbsandsteingebirge herangebracht. Abgeschlossen wurde das Gebäude nach oben hin von überlebensgrossen Sandsteinfiguren. Sie stellen die einzelnen Wissenschaften dar und wurden von dem berühmten Bildhauer Rudolf Kaplunger aus dem Stein geschlagen.
Zentrum von Schloss Ludwigslust wurde der "Goldene Saal", ein mächtiger, auf Säulen gestützter Saal, der zwei Etagen hoch ist. Offenbar ging den Bauherren im Laufe der Zeit das Geld aus, denn die Dekorationen, die hier verwendet wurden, bestehen grösstenteils aus Karton. Dieses Material war bedeutend günstiger als Holz und Marmor und senkte die Kosten für den Bau von Schloss Ludwigslust beträchtlich. Neben dem Saal wurden auch noch zahlreiche Prunkräume wie das Miniaturenkabinett und das Jagdzimmer eingerichtet. Sie sind heute noch genauso erhalten wie zu Zeiten ihrer Erschaffung und werden als Museum benutzt. Hier kann man sich veranschaulichen, wie fürstlich man im 18. Jahrhundert auf Schloss Ludwigslust gelebt hatte.
So gross und prächtig Schloss Ludwigslust ist, bot es seiner Zeit doch nicht genug Platz, um den ganzen Hof hier unterzubringen. Lediglich der Herzog und seine direkten Angehörigen lebten hier. Das Schloss hatte also vor allem repräsentative Zwecke zu erfüllen. Die Mitglieder des Hofes, die auf Schloss Ludwigslust keinen Platz fanden, wurden in den kleinen Palästen untergebracht, die man rund um den Schlossplatz errichtet hatte. Sie waren aber zum grossen Teil älter als Schloss Ludwigslust und hatten bereits das Jagdschloss umrahmt. Dementsprechend boten sie ihren Bewohnern auch bei Weitem nicht so viel Luxus und Komfort, wie es das neu erbaute Schloss Ludwigslust tat.
Bereits bevor man damit begann, Schloss Ludwigslust zu errichten, wurde der Bau einer Hofkirche in Angriff genommen. Die Grundsteinlegung, der Kirche, die später die Hofkirche von Schloss Ludwigslust war, fand im Jahr 1765 statt. Insgesamt dauerte der Bau fünf Jahre. Während die Kirche von aussen durch einen klassizistischen Stil geprägt wurde, findet man im Inneren des Gebäudes ein grosses Gemälde zur Geburt Christi. Zwei Maler arbeiteten über dreissig Jahre an dem Gemälde der Hofkapelle von Schloss Ludwigslust. Gleich hinter dem Gemälde befindet sich eine Orgel, die im Jahr 1876 gebaut worden war. Sie folgte also, als Schloss Ludwigslust als Herzogspalast längst schon wieder aufgegeben worden war. Unter dem Boden der Kirche befindet sich die Fürstengruft, in der die Herrscher von Schloss Ludwigslust bestattet wurden. Auffälligstes Merkmal der Kirche ist aber der frei stehende Glockenturm, der sich mehrere hundert Meter von der Kirche entfernt befindet.
Ebenfalls schon vor dem Bau von Schloss Ludwigslust wurde der barocke Garten angelegt. Besonders beeindruckend sind die vielen Wasserspiele, die man in den Brunnen und Kanälen des Parks bewundern konnte. Damit diese mit genügend Wasser gespeist werden konnte, baute man von 1756 bis 1760 einen vier Meter breiten Kanal, der Stör und Rögnitz miteinander verband. Insgesamt war dieser Kanal, der noch heute die Gewässer des Parks von Schloss Ludwigslust speist, 28 Kilometer lang.
Im Jahr 1837 wurde Schloss Ludwigslust als Residenz der Mecklenburger Herzöge wieder aufgegeben. Man kehrte zurück in das zu dieser Zeit sehr baufällige Schloss Schwerin. Schloss Ludwigslust blieb zwar vorerst weiter im Besitz der Herzöge, wurde aber nur noch sporadisch genutzt. Die grössten Umbaumaßnahmen, die nach dem Weggang des Hofes an Schloss Ludwigslust vorgenommen worden waren, betrafen den einstmals barocken Schlossgarten. Er wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts von dem berühmten Gartenarchitekten Peter Joseph Lenné umgestaltet. Es gibt mehrere Alleen, die sternförmig aufeinander treffen. Darüber hinaus wurden im Laufe der Jahre zahlreiche Denkmäler und kleine Häuser im Park von Schloss Ludwigslust angelegt.
Nach dem Untergang des Kaiserreichs und der Entmachtung der Adligen ging Schloss Ludwigslust in den Besitz des Staates über. Heute wird es vom Staatlichen Museum Schwerin genutzt. Neben der Ausstattung von Schloss Ludwigslust wird hier auch Kunst gezeigt.
(rh)
Heute lädt Schloss Ludwigslust zu einer Besichtigung zu den angegebenen Öffnungszeiten ein. Im Gebäude befindet sich heute ein Museum. Zu Schloss Ludwigslust liegen mir noch keine Informationen zu einem Hotel vor. Im Objekt ist keine Gastronomie vorhanden oder mir liegen keine Informationen über ein mögliches Bistro, Café oder Restaurant vor. Zu Schloss Ludwigslust liegen mir keine Details zu einem Standesamt vor. Zu einer Kirche oder Kapelle direkt auf dem Gelände liegen mir keine Informationen vor.
Dieser Text wurde von den Mitarbeitern meiner Redaktion recherchiert und geschrieben und ist urheberrechtlich geschützt. Falls Sie Fragen oder Anregungen dazu haben, schreiben Sie mir gerne.
Bei Burgen-und-Schloesser.net finden Sie eine umfangreiche Übersicht über Schlösser, Burgen und Ruinen
in ganz Deutschland. Suchen Sie ganz einfach nach Ihrem Traumschloss für Hochzeit, Event oder Ausflug.
Hier finden Sie nicht nur Schlösser zum Besichtigen oder Feiern, sondern auch Schloss Immobilien zum kaufen oder mieten, exklusive Schlossrestaurants oder Burgcafés,
aber auch Schlosshotels und Burghotels zum Übernachten und für Tagungen.
Burgen und Schlösser in Deutschland
Burgen und Schlösser in Deutschland
·


